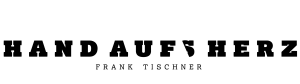Weg mit alten Zöpfen
Es geisterte in den letzten Wochen durch den Blätterwald: Die Bundeswehr rüstet ab – bei den Friseuren (das ist kein Scherz!). Die Truppenfriseure, insgesamt 67 Friseurstuben, werden in einem Zeitraum von fünf Jahren abgeschafft. Was hat die Bundeswehr zu dem rabiaten Schritt veranlasst, diesen alten Zopf abzuschneiden? War es etwa die Tatsache, dass die Truppen-Friseure den Ansprüchen der an Zahl zunehmenden Soldatinnen nicht gerecht werden können und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen wahrscheinlich auch eher Udo Walz in Berlin aufsucht als den Truppenfriseur in Stetten am kalten Markt?
Nein! Der Grund sind einfach die Kosten und – jetzt komme ich als Vertreter des Handwerks auf den Punkt – weil örtliche Friseursalons es mindestens genauso gut können. Festgestellt hat dies übrigens nicht das Verteidigungsministerium, sondern der Bundesrechnungshof, der etwas verschwurbelt festgestellt hat, dass „weder hygienische Erfordernisse nach dem Infektionsschutzgesetz noch Vorschriften zur Haartracht oder Anforderungen an das äußere Erscheinungsbild“ Truppenfriseure erforderten. Die Vorgaben der entsprechenden Vorschriften könnten auch von ortsansässigen Friseuren sichergestellt werden, was für eine „überraschende“ Erkenntnis. Es sei nicht ersichtlich, wie ein Friseurbesuch den militärischen Dienst beeinträchtigen könne. So stand es im SPIEGEL und das sagen einem auch der gesunde Menschenverstand und die Erfahrung.
Für das Handwerk ist das eine gute Nachricht, nicht nur weil zukünftig unseren Vaterlandsverteidigern der Bundeswehr-Einheitsschnitt erspart bleibt, sondern weil hier endlich auch das Subsidiaritätsprinzip greift. Nur dort, wo die Möglichkeiten des Einzelnen bzw. einer kleinen Gruppe nicht ausreichen, Aufgaben zu lösen, sollen staatliche Institutionen ersatzweise eingreifen. Und wer wollte bestreiten, dass die Friseursalons mit ihren gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht auch einen Soldatenkopf fachgerecht behandeln können. Das Preis-Leistungsverhältnis eines ansässigen Friseurbetriebes ist mit Sicherheit dem des Truppenfriseurs ebenwürdig, denn diese wurden jedes Jahr mit einer halben Millionen Euro Steuergelder (!) subventioniert. Wie viele Überbetriebliche Ausbildungswerkstätten im Friseurbereich hätte man damit modernisieren können!
Im Falle der Bundeswehr und ihrer Friseure vermute ich mehr ein „War schon immer so“ als ein „Wir wollen sparen.“ Bei den Kommunen ist dies nicht immer so. Viele Städte und Gemeinden versuchen angesichts ihrer finanziell schwierigen Lage durch wirtschaftliche Betätigung in vermeintlich gewinnbringenden Bereichen zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Die wirtschaftliche Betätigung erfolgt in diesen Fällen nicht mehr, weil dies ein „dringender öffentlicher Zweck“ erfordert, sondern aus schlichtem finanzwirtschaftlichem Eigeninteresse der jeweiligen Kommune und außerhalb der kommunalen Daseinsvorsorge.
Ohne dass sie sich dem privatwirtschaftlichen Risiko stellen müssen, treten sie in unmittelbare Konkurrenz zu Handwerksunternehmen aus dem Bau- und Ausbaugewerken und der Kfz-Branche. Seit dem Inkrafttreten des § 107 der Gemeindeordnung von NRW wurde zumindest die Hürde für die wirtschaftliche Betätigung einer Gemeinde höher gelegt, ganz unüberwindbar ist sie bis heute nicht.
Deshalb zum Schluss mein Merksatz an die Kommunen und staatliche Einrichtungen: „Die Hand, die einen füttert, sollte man nicht beißen.“
Dem Handwerksunternehmen, das Arbeits- und Ausbildungsplätze schafft und Steuern zahlt, sollte man nicht durch unfaire Konkurrenz die Existenzgrundlage nehmen.
Ihr
Frank Tischner
Rückmeldungen gerne unter feedback@handaufsherz.blog